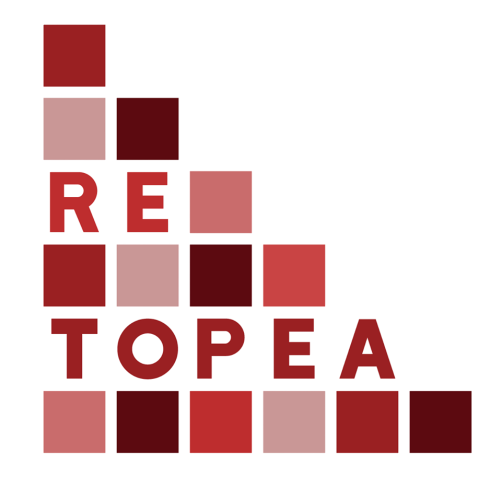Rahmenabkommen von Ohrid: der "Geist des Abkommens"
Das Rahmenabkommen von Ohrid ist eine Regelung, die einen siebenmonatigen Konflikt in Nordmazedonien im Jahr 2001 beendete. Es wurde von der Regierung Nordmazedoniens und Vertretern der albanischen Gemeinschaft im Land unterzeichnet. Die meisten, aber nicht alle ethnischen Albaner in Nordmazedonien sind Muslime. Die ethnischen Mazedonier sind überwiegend ostorthodoxe Christen. Neben religiösen Unterschieden sprechen beide Gruppen eine unterschiedliche Sprache. In den Jahren vor 2001 hatten sich Spannungen zwischen den beiden Gruppen aufgebaut. In der ersten Hälfte dieses Jahres kam es zu offener Gewalt. Das Rahmenabkommen von Ohrid befriedete diesen Konflikt. Es regelte die Entwaffnung der albanischen Milizen. Außerdem gewährte es den Minderheitengruppen sprachliche und kulturelle Rechte.
Nach der Ratifizierung des Rahmenabkommens von Ohrid (OFA) wurden seine fünf Grundprinzipien sowohl im Inland als auch international intensiv diskutiert. In Nordmazedonien drehten sich die Diskussionen oft um den sogenannten „Geist des Abkommens“, wobei Experten seine Grundlagen in Frage stellten. Viele argumentierten, dass das OFA nicht nur als Waffenstillstand diene, sondern in erster Linie eine Verfassungsreform ermöglichen solle, um die Mängel der republikanischen Verfassung von 1991 bei der Bewältigung interethnischer Spannungen zu beheben.
Der „Geist“ des Abkommens ging über formelle Verpflichtungen hinaus und umfasste Bemühungen zur Verbesserung der interethnischen Beziehungen in den Jahren nach der Einigung. Vor dem Konflikt im Jahr 2001 rechnete die mazedonische Gesellschaft nicht mit bewaffneter Gewalt, da sie davon ausging, dass die Forderungen der Minderheiten innerhalb der staatlichen Institutionen geklärt werden würden. Das osmanische Erbe des Landes wurde oft als Beweis für eine langjährige Tradition des Zusammenlebens angeführt. Im Jahr 2000 wurde diese Idee durch ein künstlerisches Projekt in Skopje namens Komşi Kapicik erforscht, das die multikonfessionelle Toleranzkultur Mazedoniens untersuchte. Der Titel des Projekts – ein türkischer Ausdruck, der sich auf eine kleine Gartentür bezieht, die benachbarte Haushalte verbindet – symbolisierte die tief verwurzelten interethnischen und interreligiösen Verbindungen, die die mazedonische Gesellschaft historisch geprägt hatten. Die Schöpfer des Projekts kritisierten Versuche, westliche Modelle des Multikulturalismus durchzusetzen, ohne die lokalen Traditionen zu berücksichtigen.
Nach dem Konflikt von 2001 entwickelte sich dieses Konzept zu dem, was Experten als „mazedonisches Modell des Multikulturalismus“ bezeichneten. Die Idee, die auf dem Erbe des gemeinsamen Lebens über religiöse und ethnische Grenzen hinweg beruht, gewann in den 2010er Jahren an Bedeutung. Der Präsident Nordmazedoniens bewarb dieses Modell in Vorträgen in ganz Europa und Nordamerika und stellte es als Vorbild für die Region vor. Er betonte, dass Mazedonien zeige, wie Muslime und Christen ohne Angst oder Vorurteile zusammenleben können, und hob den einzigartigen Ansatz des Landes hervor, Vielfalt zu begrüßen.
Sind Sie der Meinung, dass lokale Traditionen, Bräuche und historische Zusammenhänge in das Rechtssystem integriert werden sollten? Fallen Ihnen Beispiele aus Ihrem eigenen Umfeld ein?
Weitere Informationen zu diesem und anderen Friedensverträgen finden Sie unter