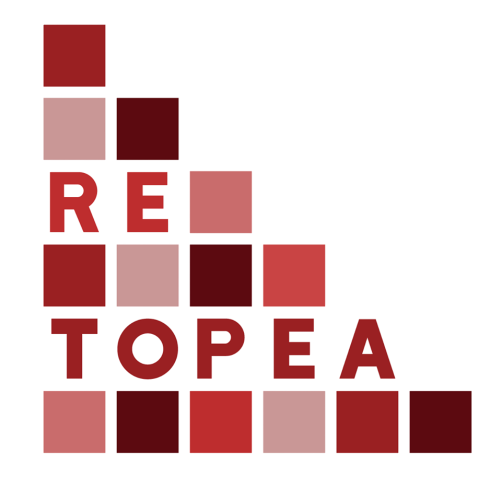Völkerbund: Streit um die Åland-Inseln
Der Åland/Aland-Inseln-Streit war einer der ersten Fälle, die vom Völkerbund einem Schiedsverfahren unterzogen wurden. Er gilt auch als einer der Fälle, die vom Völkerbund erfolgreich beigelegt wurden. 1920 forderte die ethnisch schwedische Bevölkerung der finnischen Åland-Inseln den Anschluss an Schweden. Der Rat des Völkerbundes nahm sich der Angelegenheit an und entsandte eine neutrale Kommission auf die Inseln. 1921 beschloss der Rat, dass die Inseln bei Finnland verbleiben sollten. Diese Entscheidung wurde sowohl von der finnischen als auch von der schwedischen Regierung respektiert. Die finnische Regierung erklärte sich außerdem bereit, die kulturellen und sprachlichen Rechte der lokalen Bevölkerung zu schützen. Obwohl diese Vereinbarung nicht Teil der Minderheitenabkommen des Völkerbundes war, „bot sie den Åländern sowohl Minderheitenschutz als auch eine Organisation zur Entwicklung der lokalen Selbstverwaltung“.
Der Völkerbund wurde 1919 mit den Versailler Verträgen gegründet und war eine internationale Organisation. Sein Hauptziel war es, einen weiteren Weltkrieg zu verhindern. Um dies zu erreichen, befasste sich der Bund mit diplomatischen Angelegenheiten und Sicherheitsfragen. Die Organisation schlichtete internationale Streitigkeiten und militärische Rivalitäten. Sie förderte ein System zum Schutz von Minderheiten und verwaltete direkt umstrittene Gebiete (wie das Saargebiet oder die Stadt Danzig). Der Völkerbund war auch in Bereichen wie Gesundheitsfragen, Rechte des geistigen Eigentums und Normungsfragen tätig. Die letzte Sitzung des Völkerbundes fand am 18. April 1946 in Genf statt. Er wurde durch die Vereinten Nationen ersetzt.
Hilft Ihnen dieser Auszug zu verstehen, wie der Völkerbund an die Lösung von Minderheitenproblemen in Europa heranging?