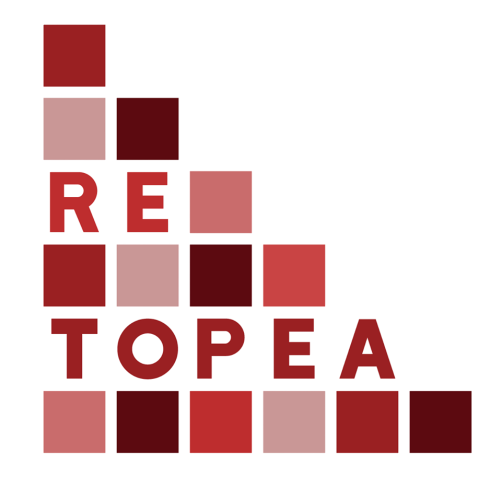Rahmenabkommen von Ohrid: ein mazedonisches Modell des Multikulturalismus (#1)?
Die mazedonische Gesellschaft hat 2001 keinen bewaffneten Konflikt erwartet. Man erwartete, dass die Forderungen der Minderheitengruppen innerhalb der staatlichen Institutionen und ohne gewaltsame Eskalation erfüllt werden würden. Vor dem Konflikt wurde die osmanische Geschichte des Staates genutzt, um das Erbe des gemeinsamen Lebens zu veranschaulichen. Im Jahr 2000 wurde in Skopje das künstlerische Projekt "Komşi Kapicik" ins Leben gerufen, das die Kultur der multikonfessionellen Toleranz in Mazedonien untersuchen sollte. Komşi Kapicik" ist ein türkischer Ausdruck für eine kleine Gartentür, die zwei benachbarte Anwesen miteinander verbindet. Diese Tür war in der Mehrzahl der Haushalte vorhanden, unabhängig von der religiösen oder ethnischen Herkunft der Familien.
Die Autoren des Projekts standen der Idee kritisch gegenüber, ein westliches Modell des Multikulturalismus durchzusetzen, ohne die lokalen Traditionen und die Geschichte des gemeinsamen Lebens zu berücksichtigen. Darüber hinaus begann nach dem Aufstand von 2001 eine Expertengruppe mit der Entwicklung der Idee eines "mazedonischen Modells des Multikulturalismus". Die Idee basierte auf dem Erbe des multikulturellen Zusammenlebens in Mazedonien.
Das Rahmenabkommen von Ohrid ist eine Regelung, die einen siebenmonatigen Konflikt in Nordmazedonien im Jahr 2001 beendete. Es wurde von der Regierung Nordmazedoniens und Vertretern der albanischen Gemeinschaft im Land unterzeichnet. Die meisten, aber nicht alle ethnischen Albaner in Nordmazedonien sind Muslime. Die ethnischen Mazedonier sind überwiegend ostorthodoxe Christen. Neben religiösen Unterschieden sprechen beide Gruppen eine unterschiedliche Sprache. In den Jahren vor 2001 hatten sich Spannungen zwischen den beiden Gruppen aufgebaut. In der ersten Hälfte dieses Jahres kam es zu offener Gewalt. Das Rahmenabkommen von Ohrid befriedete diesen Konflikt. Es regelte die Entwaffnung der albanischen Milizen. Es gewährte den Minderheitengruppen auch sprachliche und kulturelle Rechte.
For more information on this and other peace treaties, see
myTitle
Trajanovski a5 Ohrid Framework Agreement a Macedonian model of multiculturalism (#1).xlsx
Titel
Rahmenabkommen von Ohrid: ein mazedonisches Modell des Multikulturalismus (#1)?
content
Die mazedonische Gesellschaft hat 2001 keinen bewaffneten Konflikt erwartet. Man erwartete, dass die Forderungen der Minderheitengruppen innerhalb der staatlichen Institutionen und ohne gewaltsame Eskalation erfüllt werden würden. Vor dem Konflikt wurde die osmanische Geschichte des Staates genutzt, um das Erbe des gemeinsamen Lebens zu veranschaulichen. Im Jahr 2000 wurde in Skopje das künstlerische Projekt "Komşi Kapicik" ins Leben gerufen, das die Kultur der multikonfessionellen Toleranz in Mazedonien untersuchen sollte. Komşi Kapicik" ist ein türkischer Ausdruck für eine kleine Gartentür, die zwei benachbarte Anwesen miteinander verbindet. Diese Tür war in der Mehrzahl der Haushalte vorhanden, unabhängig von der religiösen oder ethnischen Herkunft der Familien.
Die Autoren des Projekts standen der Idee kritisch gegenüber, ein westliches Modell des Multikulturalismus durchzusetzen, ohne die lokalen Traditionen und die Geschichte des gemeinsamen Lebens zu berücksichtigen. Darüber hinaus begann nach dem Aufstand von 2001 eine Expertengruppe mit der Entwicklung der Idee eines "mazedonischen Modells des Multikulturalismus". Die Idee basierte auf dem Erbe des multikulturellen Zusammenlebens in Mazedonien.
Die Autoren des Projekts standen der Idee kritisch gegenüber, ein westliches Modell des Multikulturalismus durchzusetzen, ohne die lokalen Traditionen und die Geschichte des gemeinsamen Lebens zu berücksichtigen. Darüber hinaus begann nach dem Aufstand von 2001 eine Expertengruppe mit der Entwicklung der Idee eines "mazedonischen Modells des Multikulturalismus". Die Idee basierte auf dem Erbe des multikulturellen Zusammenlebens in Mazedonien.
Beschreibung
Künstlerisches Projekt über die mazedonische Multikonfessionalität.
Context
Das Rahmenabkommen von Ohrid ist eine Regelung, die einen siebenmonatigen Konflikt in Nordmazedonien im Jahr 2001 beendete. Es wurde von der Regierung Nordmazedoniens und Vertretern der albanischen Gemeinschaft im Land unterzeichnet. Die meisten, aber nicht alle ethnischen Albaner in Nordmazedonien sind Muslime. Die ethnischen Mazedonier sind überwiegend ostorthodoxe Christen. Neben religiösen Unterschieden sprechen beide Gruppen eine unterschiedliche Sprache. In den Jahren vor 2001 hatten sich Spannungen zwischen den beiden Gruppen aufgebaut. In der ersten Hälfte dieses Jahres kam es zu offener Gewalt. Das Rahmenabkommen von Ohrid befriedete diesen Konflikt. Es regelte die Entwaffnung der albanischen Milizen. Es gewährte den Minderheitengruppen auch sprachliche und kulturelle Rechte.
Questions
Sind Sie der Meinung, dass die lokalen Vermächtnisse, Traditionen und Geschichten in das Rechtssystem aufgenommen werden sollten? Können Sie sich an ein Beispiel aus Ihrer unmittelbaren Umgebung erinnern?
Zeitlicher Geltungsbereich
21. Jahrhundert
Räumlicher Geltungsbereich
Nord-Mazedonien
map
42 / 21.433333
Zuordnung
Thema
Is Referenced By
Abschrift von
Branislav Sarkanjac and Nebojša Viliḱ (eds), Komši-kapidžik: kultura i politika [Komşi-kapicik: culture and politics] (Skopje: 359 Mreža za lokalni i subaltern hermenevtiki, 2000).
Zielgruppe
Yes
Urheber
Naum Trajanovski