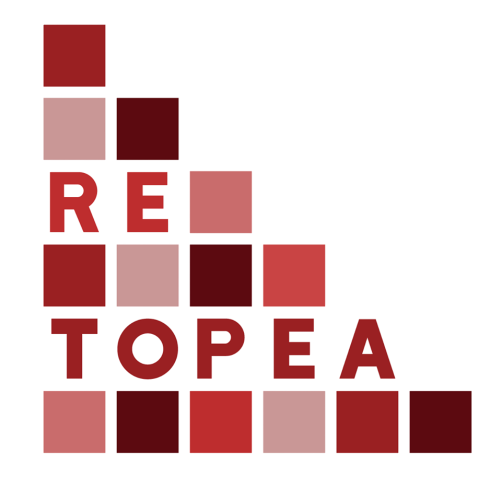Pariser Friedensverträge: Kleiner Vertrag von Versailles (#2)
Artikel 7 des am 28. Juni 1919 unterzeichneten polnischen Minderheitenvertrags lautet wie folgt:
"Alle polnischen Staatsangehörigen sind vor dem Gesetz gleich und genießen die gleichen bürgerlichen und politischen Rechte ohne Unterschied der Rasse, Sprache oder Religion. Unterschiede in der Religion, im Glauben oder in der Konfession lassen die polnischen Staatsangehörigen in Angelegenheiten, die den Genuss der bürgerlichen oder politischen Rechte betreffen, wie z.B. die Zulassung zur öffentlichen Arbeit, zu Funktionen und Ehrungen oder die Ausübung von Berufen und Industrien, unberührt. Der freie Gebrauch einer Sprache durch polnische Staatsangehörige im privaten Bereich, im Handel, in der Religion, in der Presse oder in Veröffentlichungen aller Art oder bei öffentlichen Versammlungen darf nicht eingeschränkt werden."
Kontext:
Die Pariser Friedenskonferenz fand 1919 in Versailles statt. Ziel der Konferenz war es, Friedensbedingungen zwischen den beiden kriegführenden Seiten des Ersten Weltkriegs - den siegreichen Alliierten und den besiegten Mittelmächten - festzulegen. Die Konferenz begann am 18. Januar 1919 und wurde weitgehend als ein Präzedenzfall für die Schaffung der neuen Nachkriegsordnung angesehen. Nach dem Ersten Weltkrieg gehörte in der neu gegründeten polnischen Republik etwa ein Drittel der Gesamtbevölkerung den nationalen Minderheiten an. Die wichtigsten Konfessionen unter diesen Minderheitengruppen waren die orthodoxen Christen, die Judaisten, die Calvinisten und die lutherischen Protestanten. Dennoch hatte der polnische römische Katholizismus als religiöse Konfession der Mehrheitsgruppe den Vorrang in der neuen Republik. Gemäß der polnischen Verfassung von 1921 "nimmt die römisch-katholische Religion als Religion der überwiegenden Mehrheit der Nation im Staat die Hauptposition unter den befreiten Religionen ein".
For more information on this and other peace treaties, see
Titel
content
Unterschiede in der Religion, im Glauben oder in der Konfession lassen die polnischen Staatsangehörigen in Angelegenheiten, die den Genuss der bürgerlichen oder politischen Rechte betreffen, wie z.B. die Zulassung zur öffentlichen Arbeit, zu Funktionen und Ehrungen oder die Ausübung von Berufen und Industrien, unberührt.
Der freie Gebrauch einer Sprache durch polnische Staatsangehörige im privaten Bereich, im Handel, in der Religion, in der Presse oder in Veröffentlichungen aller Art oder bei öffentlichen Versammlungen darf nicht eingeschränkt werden.
Fragen: Was bedeutet es, die Rechte von Minderheiten zu schützen? Sollten sich die Rechte von Minderheiten von den Rechten der Mehrheit unterscheiden?
Context
Nach dem Ersten Weltkrieg gehörte in der neu gegründeten polnischen Republik etwa ein Drittel der Gesamtbevölkerung den nationalen Minderheiten an. Die wichtigsten Konfessionen unter diesen Minderheitengruppen waren die orthodoxen Christen, die Judaisten, die Calvinisten und die lutherischen Protestanten. Dennoch hatte der polnische römische Katholizismus als religiöse Konfession der Mehrheitsgruppe den Vorrang in der neuen Republik. Gemäß der polnischen Verfassung von 1921 "nimmt die römisch-katholische Religion als Religion der überwiegenden Mehrheit der Nation im Staat die Hauptposition unter den befreiten Religionen ein".