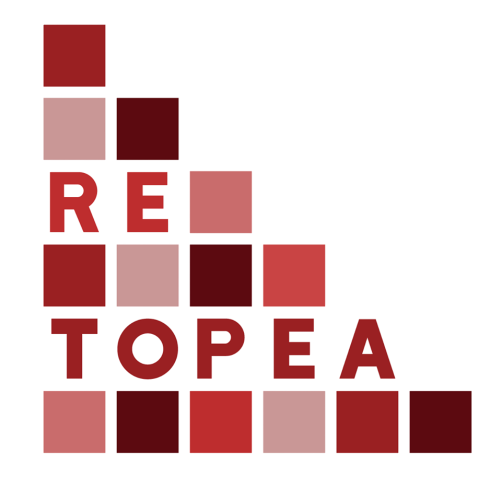Edikt von Saint-Germain: Religiöse Objekte
Dieser Ausschnitt zeigt, wie durch religiöse Objekte Konflikte ausgelöst wurden und welche Maßnahmen zur Lösung solcher Konflikte ergriffen wurden.
Im Edikt von Saint-Germain heißt es, dass die Protestanten religiöse Ornamente, Bilder und Reliquien zurückgeben oder Entschädigung zahlen mussten. Solche Objekte spielten oft eine zentrale Rolle in den Spannungen zwischen Katholiken und Protestanten. Den Katholiken halfen diese Objekte bei der Verehrung von Heiligen und bei der Pflege ihrer Verbindung zu Gott. Die Protestanten in Frankreich lehnten die Verwendung solcher Objekte generell ab. Sie glaubten, dass sie die Beziehung zu Gott verunreinigen und eine falsche Götzenanbetung darstellen. In Fällen gewalttätiger Ausschreitungen richteten sich die Protestanten vor allem gegen diese Gegenstände. So drang beispielsweise 1561 eine Gruppe von Protestanten in das katholische Karmeliterkloster in Albiac ein. Dort nahmen sie die örtlichen Reliquien mit, zeigten sie den Menschen und riefen: "Schaut, es sind nur Tierknochen!" Die im Edikt enthaltene Regel über Rückgabe und Entschädigung sollte also solche Wunden innerhalb der Gemeinden heilen.
Das Edikt von Saint-Germain (1562) war ein vom französischen König erlassenes Gesetz. Es gewährte den Protestanten begrenzte Rechte auf die Religionsausübung in Frankreich. In den vorangegangenen Jahrzehnten war der Protestantismus in verschiedenen Teilen Frankreichs populär geworden. Der französische König, der selbst katholisch war, verfolgte zunächst die Protestanten. Abweichungen vom Katholizismus hielt er für illegal. Trotz dieser Verfolgung wuchs der Protestantismus in Frankreich weiter. Zunächst versammelten sich die Protestanten und feierten im Verborgenen. Mit der Zeit begannen sie auch, sich zu versammeln und öffentlich Gottesdienst zu feiern. Dies führte zu einer angespannten Situation in ganz Frankreich.
Das Edikt von Saint-Germain versuchte, ein friedliches Zusammenleben zwischen Protestanten und Katholiken zu gewährleisten. Es gab ihnen begrenzte Rechte auf Gottesdienste außerhalb der Städte. Es stieß jedoch auf den Widerstand der katholischen Adeligen und Richter, die es für inakzeptabel hielten, das Recht auf Religionsausübung auf Protestanten auszudehnen. Aufgrund dieser Opposition hielten die Spannungen an. Die Protestanten glaubten, dass es ihnen nun erlaubt sei, öffentlich Gottesdienst zu feiern, wurden manchmal aber trotzdem angegriffen. Sie reagierten darauf, indem sie die Kontrolle über die lokale Regierung in verschiedenen französischen Städten übernahmen. Dies führte im Sommer 1562 zum Ausbruch des ersten französischen Religionskrieges. In den folgenden 37 Jahren folgten Religionskriege und vorübergehende Befriedungsgesetze aufeinander.
For more information on this and other peace treaties, see
Titel
Edikt von Saint-Germain: Religiöse Objekte
content
Im Edikt von Saint-Germain heißt es, dass die Protestanten religiöse Ornamente, Bilder und Reliquien zurückgeben oder Entschädigung zahlen mussten. Solche Objekte spielten oft eine zentrale Rolle in den Spannungen zwischen Katholiken und Protestanten. Den Katholiken halfen diese Objekte bei der Verehrung von Heiligen und bei der Pflege ihrer Verbindung zu Gott. Die Protestanten in Frankreich lehnten die Verwendung solcher Objekte generell ab. Sie glaubten, dass sie die Beziehung zu Gott verunreinigen und eine falsche Götzenanbetung darstellen. In Fällen gewalttätiger Ausschreitungen richteten sich die Protestanten vor allem gegen diese Gegenstände. So drang beispielsweise 1561 eine Gruppe von Protestanten in das katholische Karmeliterkloster in Albiac ein. Dort nahmen sie die örtlichen Reliquien mit, zeigten sie den Menschen und riefen: "Schaut, es sind nur Tierknochen!" Die im Edikt enthaltene Regel über Rückgabe und Entschädigung sollte also solche Wunden innerhalb der Gemeinden heilen.
Beschreibung
Dieser Ausschnitt zeigt, wie durch religiöse Objekte Konflikte ausgelöst wurden und welche Maßnahmen zur Lösung solcher Konflikte ergriffen wurden.
Context
Das Edikt von Saint-Germain (1562) war ein vom französischen König erlassenes Gesetz. Es gewährte den Protestanten begrenzte Rechte auf die Religionsausübung in Frankreich. In den vorangegangenen Jahrzehnten war der Protestantismus in verschiedenen Teilen Frankreichs populär geworden. Der französische König, der selbst katholisch war, verfolgte zunächst die Protestanten. Abweichungen vom Katholizismus hielt er für illegal. Trotz dieser Verfolgung wuchs der Protestantismus in Frankreich weiter. Zunächst versammelten sich die Protestanten und feierten im Verborgenen. Mit der Zeit begannen sie auch, sich zu versammeln und öffentlich Gottesdienst zu feiern. Dies führte zu einer angespannten Situation in ganz Frankreich.
Das Edikt von Saint-Germain versuchte, ein friedliches Zusammenleben zwischen Protestanten und Katholiken zu gewährleisten. Es gab ihnen begrenzte Rechte auf Gottesdienste außerhalb der Städte. Es stieß jedoch auf den Widerstand der katholischen Adeligen und Richter, die es für inakzeptabel hielten, das Recht auf Religionsausübung auf Protestanten auszudehnen. Aufgrund dieser Opposition hielten die Spannungen an. Die Protestanten glaubten, dass es ihnen nun erlaubt sei, öffentlich Gottesdienst zu feiern, wurden manchmal aber trotzdem angegriffen. Sie reagierten darauf, indem sie die Kontrolle über die lokale Regierung in verschiedenen französischen Städten übernahmen. Dies führte im Sommer 1562 zum Ausbruch des ersten französischen Religionskrieges. In den folgenden 37 Jahren folgten Religionskriege und vorübergehende Befriedungsgesetze aufeinander.
Das Edikt von Saint-Germain versuchte, ein friedliches Zusammenleben zwischen Protestanten und Katholiken zu gewährleisten. Es gab ihnen begrenzte Rechte auf Gottesdienste außerhalb der Städte. Es stieß jedoch auf den Widerstand der katholischen Adeligen und Richter, die es für inakzeptabel hielten, das Recht auf Religionsausübung auf Protestanten auszudehnen. Aufgrund dieser Opposition hielten die Spannungen an. Die Protestanten glaubten, dass es ihnen nun erlaubt sei, öffentlich Gottesdienst zu feiern, wurden manchmal aber trotzdem angegriffen. Sie reagierten darauf, indem sie die Kontrolle über die lokale Regierung in verschiedenen französischen Städten übernahmen. Dies führte im Sommer 1562 zum Ausbruch des ersten französischen Religionskrieges. In den folgenden 37 Jahren folgten Religionskriege und vorübergehende Befriedungsgesetze aufeinander.
Questions
Fällt Ihnen ein Objekt ein, das Ihnen heilig ist? Betrachten andere es auch als heilig oder verehrungswürdig?
Zeitlicher Geltungsbereich
16. Jahrhundert
Räumlicher Geltungsbereich
Europa
Frankreich
map
48.8989 / 2.0938
Thema
Is Referenced By
Biblografische Zitierungen
Nathalie Zemon Davis, The Rites of Violence: Religious Riot in Sixteenth-Century France, Past & Present, 59, 1973, p 51-91
Urheber
Christophe Schellekens