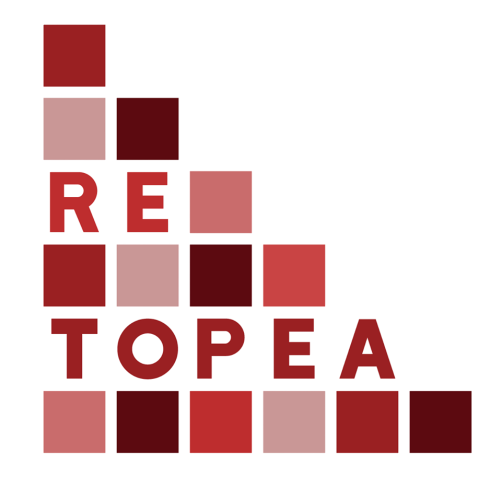Das Edikt von Nantes und die Kommissare
Nachdem das Edikt von Nantes 1598 unterzeichnet und bekannt gegeben worden war, musste es im gesamten französischen Königreich in die Tat umgesetzt werden. Zu diesem Zweck wurden Kommissare in Städte und Dörfer entsandt. Dort mussten sie sich vergewissern, dass die Maßnahmen zur Friedenssicherung und zur Beilegung religiöser Konflikte befolgt werden würden. Die Kommissionen mussten sowohl aus einem Katholiken als auch aus einem Protestanten zusammengesetzt sein. Wenn sie eine Gemeinde besuchten, erklärten die Kommissare zunächst die Bestimmungen des Ediktes. Danach hörten sie sich lokale Probleme an. Bei solchen Besuchen ergaben sich einige Schwierigkeiten, wobei eine der größten die Organisation und das Gleichgewicht der lokalen Regierungen war. In vielen religiös gemischten Gemeinden verhängten die Kommissare Quoten, um sicherzustellen, dass der Anteil beider religiöser Gruppen an der lokale Verwaltung ausgewogen war. Aber diese Ausgewogenheit variierte erheblich: in Grenoble erhielten die Protestanten nur ein Zehntel der Vertretung, während sie in Valence neun Zehntel ausmachten. Der Befriedungsprozess hatte also in den zahlreichen Städten und Dörfern Frankreichs eine wichtige lokale Dimension.
Das Edikt von Nantes (1598) regelte die Beziehungen zwischen Katholiken und Protestanten in Frankreich. In den vorangegangenen 36 Jahren hatte Frankreich eine Reihe von Bürgerkriegen durchlebt. Diese Kriege wechselten sich ab mit Verträgen, die den religiösen Frieden zwischen Protestanten und Katholiken vereinbarten. Das Edikt gewährte den Protestanten das Recht auf Religionsausübung und wies ihnen verschiedene Befestigungsanlagen in Frankreich als Schutz zu. Allerdings schränkte es ihre Rechte auf andere Weise auch wieder ein. Zum Beispiel konnten Protestanten weder in Paris noch am Königshof oder in der Armee Gottesdienst feiern.
Das Edikt von Nantes blieb bis 1685 in Kraft. In diesem Jahr widerrief König Ludwig XIV. die Rechte der Hugenotten in Frankreich. Die Wahrnehmung des Ediktes von Nantes ist also geteilt. Zwar gelang es, den jahrzehntelangen Krieg zu beenden, aber das Misstrauen zwischen französischen Katholiken und Protestanten wurde nicht beseitigt. Darüber hinaus klagten die Hugenotten darüber, dass das Edikt den Katholiken erlaubte, an Stärke zu gewinnen und die Rechte der Protestanten in den folgenden Jahrzehnten zu beschneiden.
Further information about the Edict of Nantes can be found at On Site, In Time.
For more information on this and other peace treaties, see
Titel
Das Edikt von Nantes und die Kommissare
content
Nachdem das Edikt von Nantes 1598 unterzeichnet und bekannt gegeben worden war, musste es im gesamten französischen Königreich in die Tat umgesetzt werden. Zu diesem Zweck wurden Kommissare in Städte und Dörfer entsandt. Dort mussten sie sich vergewissern, dass die Maßnahmen zur Friedenssicherung und zur Beilegung religiöser Konflikte befolgt werden würden. Die Kommissionen mussten sowohl aus einem Katholiken als auch aus einem Protestanten zusammengesetzt sein. Wenn sie eine Gemeinde besuchten, erklärten die Kommissare zunächst die Bestimmungen des Ediktes. Danach hörten sie sich lokale Probleme an. Bei solchen Besuchen ergaben sich einige Schwierigkeiten, wobei eine der größten die Organisation und das Gleichgewicht der lokalen Regierungen war. In vielen religiös gemischten Gemeinden verhängten die Kommissare Quoten, um sicherzustellen, dass der Anteil beider religiöser Gruppen an der lokale Verwaltung ausgewogen war. Aber diese Ausgewogenheit variierte erheblich: in Grenoble erhielten die Protestanten nur ein Zehntel der Vertretung, während sie in Valence neun Zehntel ausmachten. Der Befriedungsprozess hatte also in den zahlreichen Städten und Dörfern Frankreichs eine wichtige lokale Dimension.
Context
Das Edikt von Nantes (1598) regelte die Beziehungen zwischen Katholiken und Protestanten in Frankreich. In den vorangegangenen 36 Jahren hatte Frankreich eine Reihe von Bürgerkriegen durchlebt. Diese Kriege wechselten sich ab mit Verträgen, die den religiösen Frieden zwischen Protestanten und Katholiken vereinbarten. Das Edikt gewährte den Protestanten das Recht auf Religionsausübung und wies ihnen verschiedene Befestigungsanlagen in Frankreich als Schutz zu. Allerdings schränkte es ihre Rechte auf andere Weise auch wieder ein. Zum Beispiel konnten Protestanten weder in Paris noch am Königshof oder in der Armee Gottesdienst feiern.
Das Edikt von Nantes blieb bis 1685 in Kraft. In diesem Jahr widerrief König Ludwig XIV. die Rechte der Hugenotten in Frankreich. Die Wahrnehmung des Ediktes von Nantes ist also geteilt. Zwar gelang es, den jahrzehntelangen Krieg zu beenden, aber das Misstrauen zwischen französischen Katholiken und Protestanten wurde nicht beseitigt. Darüber hinaus klagten die Hugenotten darüber, dass das Edikt den Katholiken erlaubte, an Stärke zu gewinnen und die Rechte der Protestanten in den folgenden Jahrzehnten zu beschneiden.
Das Edikt von Nantes blieb bis 1685 in Kraft. In diesem Jahr widerrief König Ludwig XIV. die Rechte der Hugenotten in Frankreich. Die Wahrnehmung des Ediktes von Nantes ist also geteilt. Zwar gelang es, den jahrzehntelangen Krieg zu beenden, aber das Misstrauen zwischen französischen Katholiken und Protestanten wurde nicht beseitigt. Darüber hinaus klagten die Hugenotten darüber, dass das Edikt den Katholiken erlaubte, an Stärke zu gewinnen und die Rechte der Protestanten in den folgenden Jahrzehnten zu beschneiden.
Questions
Sollten religiöse Verhältnisse und religiöses Gleichgewicht sich auf politische Regelungen auswirken?
Zeitlicher Geltungsbereich
16. Jahrhundert
Räumlicher Geltungsbereich
Europa
Frankreich
map
47.2181 / -1.5528
Thema
Is Referenced By
Biblografische Zitierungen
Daniel Hickey ‘Enforcing the Edict of Nantes: The 1599 commissions and Local Elites in Dauphine and Poitou-Aunis’, in Keith Cameron, Mark Greengrass and Penny Roberts (eds), The Adventure of Religious Pluralism in Early Modern France, Bern, 2000, p 65-85.
Zielgruppe
Yes
Urheber
Christophe Schellekens