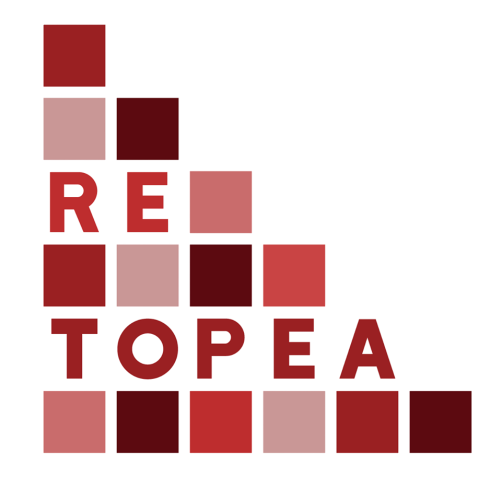Juden in Frankreich
Im späten Mittelalter vertrieb der französische König alle Juden aus seinem Königreich, und diese Politik der Unterdrückung des Judentums blieb bis ins späte 18. Jahrhundert bestehen. Es gab jedoch zwei bemerkenswerte Ausnahmen. Als Frankreich 1648 Elsass und Lothringen annektierte, durften die dort bereits ansässigen jüdischen Gemeinden bleiben. Darüber hinaus bemühte sich Frankreich im frühen 17. Jahrhundert, wohlhabende Kaufleute anzuziehen, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, und erlaubte konvertierten Juden aus Spanien und Portugal, sich in der Region Bordeaux niederzulassen. Offiziell mussten diese Personen zum Christentum konvertieren, aber in der Praxis wurde ihre Aufrichtigkeit selten überprüft, und viele praktizierten das Judentum weiterhin im privaten Rahmen.
Ende des 18. Jahrhunderts gewannen die Debatten über die Emanzipation der Juden an Fahrt. Aufklärerische Denker begannen, sich für gleiche Rechte einzusetzen, und argumentierten, dass jüdische Männer die Freiheit haben sollten, ihre Religion auszuüben und die vollen Bürgerrechte zu genießen. Die Gleichstellung schritt allmählich voran. 1785 wurde eine zusätzliche Steuer für Juden abgeschafft und ihnen das Recht gewährt, überall in Frankreich zu leben. Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 legitimierte das Judentum durch ihren zehnten Artikel weiter als akzeptierte Religion. Schließlich erkannte die Nationalversammlung im September 1791 Juden offiziell als vollwertige Bürger Frankreichs an, was einen bedeutenden Schritt in Richtung ihrer Emanzipation darstellte.
Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte (1789) entstand in einem entscheidenden Moment der französischen Geschichte und spiegelt die umfassenderen gesellschaftlichen Veränderungen dieser Zeit wider. Die von der neu gebildeten französischen Generalversammlung ausgearbeitete Erklärung war eine direkte Reaktion auf die Verfassungskrise, die Frankreich im späten 18. Jahrhundert erfasste. Diese Versammlung wurde nach dem Scheitern der traditionellen Generalstände gegründet, die der französische König einberufen hatte, um die schweren finanziellen und wirtschaftlichen Turbulenzen des Landes anzugehen. Die Generalstände bestanden aus drei verschiedenen Gruppen, die den Adel, den Klerus und den „dritten Stand“ – die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung – vertraten. Als der dritte Stand sich weigerte, separat zu tagen, löste er sich auf und bildete die Generalversammlung, ein integrativeres Gremium, das die breite Bürgerschaft vertrat.
Die Erklärung markierte eine radikale Abkehr von den historischen politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen Frankreichs. Zum ersten Mal wurden allen Männern, die Bürger waren, unabhängig von ihrer sozialen Schicht, Grundrechte gewährt. Diese Rechte waren nicht an eine bestimmte Gruppe oder ein Privileg gebunden, was einen entscheidenden Wandel hin zu Gleichheit und individuellen Freiheiten signalisierte. Zu den wichtigsten Beiträgen der Erklärung gehörte die Religionsfreiheit, die mit der langjährigen Tradition Frankreichs, den Katholizismus zu privilegieren, brach. Sie schützte unterschiedliche religiöse Ansichten und erweiterte die Gleichberechtigung auf Nichtkatholiken, darunter Juden und Protestanten, und ebnete so den Weg für mehr Inklusivität und Toleranz innerhalb der französischen Nation.
Sollten es den Regierungen möglich sein, spezifische Gesetze für bestimmte religiöse Gruppen zu erlassen, wie zum Beispiel die repressive Steuer und später das Emanzipationsgesetz für Juden in Frankreich? Oder sollten sie sich an eine allgemeine Gesetzgebung für alle Religionen halten? Warum?
Weitere Informationen zu diesem und anderen Friedensverträgen finden Sie unter