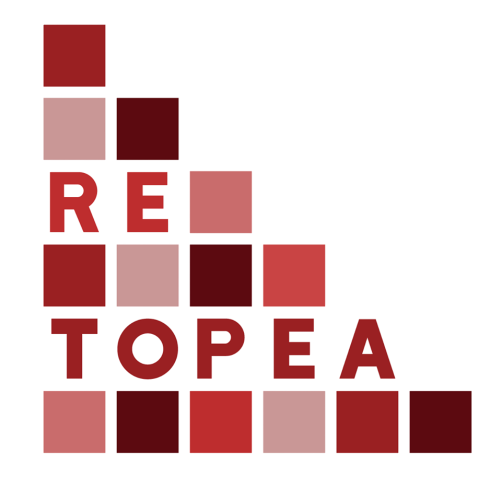Zu einem fremden Heiligen beten
Anna Boggè war die Frau eines französischen Händlers in der islamischen Stadt Izmir. Dort lebte sie inmitten einer großen Gruppe anderer Europäer. Dazu gehörten Katholiken wie sie selbst, aber auch evangelische und orthodoxe Christen. Der Pakt von Umar ermöglichte es diesen verschiedenen Religionen, in islamischen Ländern zu leben. Aber das Zusammenleben dieser verschiedenen Christen führte auch zu Spannungen. Im Jahre 1723 war Annas einzige Tochter schwer krank geworden. Um sie zu heilen, verließ sie sich nicht auf einen katholischen Priester, sondern rief nach orthodoxen Pfarrern. Diese sagten ihr, sie solle zum Heiligtum der Heiligen Jungfrau von Mettelino pilgern. Dies war nicht ganz ungewöhnlich. Wie ein katholischer Priester beklagte, gab es tatsächlich viele katholische Frauen, die zu orthodoxen heiligen Stätten gingen, wenn jemand krank wurde. Aber für den Priester war dies ein großes Problem, denn viele dieser katholischen Frauen kamen schließlich zu der Überzeugung, dass der orthodoxe Glaube ebenso gültig war wie der katholische. Einige Frauen heirateten sogar orthodoxe Männer. Anna erhielt schließlich von einer Gruppe Katholiken die Erlaubnis, die vorgeschlagene Pilgerfahrt zu unternehmen, aber es löste trotzdem einen großen Skandal aus. Die Protestanten verspotteten die Katholiken, weil sie ihren Frauen erlaubten, zu nicht-katholischen Heiligen zu beten. Ein französischer Kaufmann sagte, wenn sie seine Frau gewesen wäre, hätte er Anna getötet, bevor er sie gehen ließ. Für die islamischen Herrscher von Izmir machte das alles keinen Unterschied.
Der Pakt oder Konvent von Umar legte die Regeln fest, nach denen Nicht-Muslime wie Juden und Christen in muslimischen Ländern leben konnten. Sie erhielten diesen Schutz vor allem deshalb, weil die Muslime in den von ihnen beherrschten Ländern immer noch eine Minderheit bildeten. Die Anhänger Mohammeds hatten im siebten Jahrhundert große Teile Arabiens und des Nahen Ostens erobert, Länder, die von vielen verschiedenen Religionen bewohnt waren. Von diesen Religionen genossen die Juden und Christen einen besonderen Status, da sie als "Volk des Buches" betrachtet wurden, ähnlich wie die Muslime. Sie alle gründeten ihre Religion auf einen heiligen Text, der von einem Propheten oder Messias offenbart wurde. Obwohl es niemand genau weiß, wurden die Regeln für Nicht-Muslime wahrscheinlich von Kalif Umar I. festgelegt, der von 634 bis 644 regierte. Eines der wichtigsten Gesetze war, dass Christen und Juden eine Sondersteuer, oder Jizya, an die muslimische Regierung zahlen mussten. Als Gegenleistung erhielten sie den Status von Dhimmi, was so viel bedeutet wie "Volk des Schutzes". In den folgenden Jahrhunderten diskutierten viele muslimische Herrscher und Gelehrte über die genaue Bedeutung des Paktes von Umar und über die genauen Regeln, die für die Dhimmi in ihren Ländern galten.
Interessanterweise bezeugen viele der uns vorliegenden Quellen, dass die Christen und Juden sich diese Regeln selbst auferlegt haben. So heißt es beispielsweise in Briefen an Umar und einen seiner Befehlshaber, dass sie den Schutz des Kalifen suchten: "Als ihr [Umar] zu uns [den Christen] gekommen seid, baten wir euch um Sicherheit für unser Leben, unsere Familien und unseren Besitz und die Menschen unserer Religion unter diesen Bedingungen. Diese Bedingungen betrafen vor allem den Respekt der Christen gegenüber den Muslimen und dem islamischen Glauben sowie das Versprechen, sie nicht zu behindern.
In den letzten Jahren haben politische Gruppen auch über den Status der Dhimmi debattiert. Einige sehen sie als unterdrückte Menschen, während andere ihren Status als ein Schlüsselbeispiel für religiöse Toleranz seitens der Muslime sehen.
Titel
Zu einem fremden Heiligen beten
content
Anna Boggè war die Frau eines französischen Händlers in der islamischen Stadt Izmir. Dort lebte sie inmitten einer großen Gruppe anderer Europäer. Dazu gehörten Katholiken wie sie selbst, aber auch evangelische und orthodoxe Christen. Der Pakt von Umar ermöglichte es diesen verschiedenen Religionen, in islamischen Ländern zu leben. Aber das Zusammenleben dieser verschiedenen Christen führte auch zu Spannungen. Im Jahre 1723 war Annas einzige Tochter schwer krank geworden. Um sie zu heilen, verließ sie sich nicht auf einen katholischen Priester, sondern rief nach orthodoxen Pfarrern. Diese sagten ihr, sie solle zum Heiligtum der Heiligen Jungfrau von Mettelino pilgern. Dies war nicht ganz ungewöhnlich. Wie ein katholischer Priester beklagte, gab es tatsächlich viele katholische Frauen, die zu orthodoxen heiligen Stätten gingen, wenn jemand krank wurde. Aber für den Priester war dies ein großes Problem, denn viele dieser katholischen Frauen kamen schließlich zu der Überzeugung, dass der orthodoxe Glaube ebenso gültig war wie der katholische. Einige Frauen heirateten sogar orthodoxe Männer. Anna erhielt schließlich von einer Gruppe Katholiken die Erlaubnis, die vorgeschlagene Pilgerfahrt zu unternehmen, aber es löste trotzdem einen großen Skandal aus. Die Protestanten verspotteten die Katholiken, weil sie ihren Frauen erlaubten, zu nicht-katholischen Heiligen zu beten. Ein französischer Kaufmann sagte, wenn sie seine Frau gewesen wäre, hätte er Anna getötet, bevor er sie gehen ließ. Für die islamischen Herrscher von Izmir machte das alles keinen Unterschied.
Beschreibung
Dieser Ausschnitt enthält Informationen über Frauen eines Glaubens, die zu Heiligen aus einer anderen Religion beten.
Context
Der Pakt oder Konvent von Umar legte die Regeln fest, nach denen Nicht-Muslime wie Juden und Christen in muslimischen Ländern leben konnten. Sie erhielten diesen Schutz vor allem deshalb, weil die Muslime in den von ihnen beherrschten Ländern immer noch eine Minderheit bildeten. Die Anhänger Mohammeds hatten im siebten Jahrhundert große Teile Arabiens und des Nahen Ostens erobert, Länder, die von vielen verschiedenen Religionen bewohnt waren. Von diesen Religionen genossen die Juden und Christen einen besonderen Status, da sie als "Volk des Buches" betrachtet wurden, ähnlich wie die Muslime. Sie alle gründeten ihre Religion auf einen heiligen Text, der von einem Propheten oder Messias offenbart wurde. Obwohl es niemand genau weiß, wurden die Regeln für Nicht-Muslime wahrscheinlich von Kalif Umar I. festgelegt, der von 634 bis 644 regierte. Eines der wichtigsten Gesetze war, dass Christen und Juden eine Sondersteuer, oder Jizya, an die muslimische Regierung zahlen mussten. Als Gegenleistung erhielten sie den Status von Dhimmi, was so viel bedeutet wie "Volk des Schutzes". In den folgenden Jahrhunderten diskutierten viele muslimische Herrscher und Gelehrte über die genaue Bedeutung des Paktes von Umar und über die genauen Regeln, die für die Dhimmi in ihren Ländern galten.
Interessanterweise bezeugen viele der uns vorliegenden Quellen, dass die Christen und Juden sich diese Regeln selbst auferlegt haben. So heißt es beispielsweise in Briefen an Umar und einen seiner Befehlshaber, dass sie den Schutz des Kalifen suchten: "Als ihr [Umar] zu uns [den Christen] gekommen seid, baten wir euch um Sicherheit für unser Leben, unsere Familien und unseren Besitz und die Menschen unserer Religion unter diesen Bedingungen. Diese Bedingungen betrafen vor allem den Respekt der Christen gegenüber den Muslimen und dem islamischen Glauben sowie das Versprechen, sie nicht zu behindern.
In den letzten Jahren haben politische Gruppen auch über den Status der Dhimmi debattiert. Einige sehen sie als unterdrückte Menschen, während andere ihren Status als ein Schlüsselbeispiel für religiöse Toleranz seitens der Muslime sehen.
Interessanterweise bezeugen viele der uns vorliegenden Quellen, dass die Christen und Juden sich diese Regeln selbst auferlegt haben. So heißt es beispielsweise in Briefen an Umar und einen seiner Befehlshaber, dass sie den Schutz des Kalifen suchten: "Als ihr [Umar] zu uns [den Christen] gekommen seid, baten wir euch um Sicherheit für unser Leben, unsere Familien und unseren Besitz und die Menschen unserer Religion unter diesen Bedingungen. Diese Bedingungen betrafen vor allem den Respekt der Christen gegenüber den Muslimen und dem islamischen Glauben sowie das Versprechen, sie nicht zu behindern.
In den letzten Jahren haben politische Gruppen auch über den Status der Dhimmi debattiert. Einige sehen sie als unterdrückte Menschen, während andere ihren Status als ein Schlüsselbeispiel für religiöse Toleranz seitens der Muslime sehen.
Questions
Sollten sich die Behörden einer Religion mit den Spannungen zwischen anderen Religionen befassen? Kennen Sie Menschen, die Religionen vermischen, wie Anna?
Zeitlicher Geltungsbereich
18. Jahrhundert
Räumlicher Geltungsbereich
Türkei
map
+38.42 / +27.14
Zuordnung
Thema
Is Referenced By
Biblografische Zitierungen
Filomena Viviana Tagliaferri, Tolerance re-shaped in the early-modern Mediterranean borderlands. Travellers, missionaries and proto-journalists (1683-1724), Routledge: Abingdon, New York, 2018, 128-129.
Zielgruppe
Yes
Urheber
Bram De Ridder