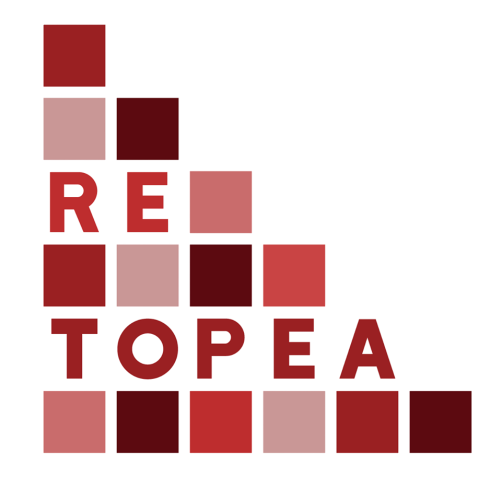Graeme Murdoch, "Kartierung des Europas der Reformation"
Der folgende Text aus einem Wissenschafts-Blog ist hilfreich für das Verständnis von Karten, die historische Situationen, insbesondere über Religion, darstellen.
"Karten können hilfreich sein. Karten können auch irreführend sein. Viele Karten des reformatorischen Europas zeigen verschiedene Religionen, die in unterschiedlichen Farben eingezeichnet sind. Man könnte daher denken, dass alle Gebiete, die mit der gleichen Farbe dargestellt sind, irgendwie vereint sind. Dabei werden jedoch Spaltungen innerhalb der Kirchen ignoriert. Viele Karten lassen vermuten, dass Staatsgrenzen auch religiöse Grenzen waren. Dies ist jedoch irreführend. Staatsgrenzen haben die protestantische und die katholische Gesellschaft oft nicht ordentlich voneinander getrennt. In vielen Gebieten überlebten Minderheitengemeinschaften (mit oder ohne das Recht, dies zu tun). Menschen, die in Grenzgebieten lebten, konnten über die Grenzen reisen, um die Kirche ihrer Wahl zu besuchen. Die Karten sollten uns nicht zum Narren halten. In vielen Teilen Europas lebten Menschen unterschiedlicher Religionen weiterhin als Nachbarn. Protestantische und katholische Gesellschaften blieben miteinander verbunden. Manchmal lebten Menschen verschiedener Religionen relativ friedlich zusammen. Manchmal führen religiöse Unterschiede zu Gewalt in den Gemeinschaften. Karten des religiösen Lebens im Europa der Reformation können hilfreich sein. Wir müssen jedoch sorgfältig über die Realitäten des täglichen Lebens nachdenken. Die von Königen und Parlamenten erlassenen Gesetze über Religion waren wichtig. Auch die Entscheidungen, die von einfachen Frauen und Männern getroffen wurden, waren wichtig für die Gestaltung des religiösen Lebens in Europa nach der Reformation".
Ein Beispiel hierfür ist in dem Ausschnitt „Augsburg 1555 – Karte: Offiziell anerkannte Religionen in europäischen Gebieten 1555“ zu sehen.
Kontext:
Die Reformation führte zu einer Spaltung der christlichen Kirche in Mitteleuropa. Theologen wie Martin Luther, Ulrich Zwingli und andere begründeten neue Lehren über den christlichen Glauben und die christliche Weltanschauung. Sie fanden bald viele Anhänger. Die verschiedenen deutschen Staaten spalteten sich zwischen der katholischen und der evangelischen Seite und teilten sich auch in zwei politische Parteien auf. Nach Jahren politischer Kämpfe führte dieser Konflikt nach 1546 sogar zu Bürgerkriegen.
1555 trafen sich die Gesandten der deutschen Staaten in Augsburg. Sie suchten nach einem Weg, den Konflikt beizulegen und die Religionskriege in Deutschland zu beenden. Der Augsburger Religionsfriede vom 25. September 1555 akzeptierte schließlich die Existenz zweier verschiedener christlicher Kirchen. Die Fürsten und Herrscher konnten sich entscheiden, ob sie bei der alten katholischen Kirche bleiben oder sich dem neuen lutherischen Glauben anschließen wollten, wie er im Augsburger Bekenntnis von 1530 formuliert war. Die lutherischen Staaten waren nun den katholischen gleichgestellt. Andere religiöse Gruppen, die mit der Reformation entstanden waren, wurden jedoch vom Friedensvertrag ausgeschlossen. Die Religionsfreiheit galt nur für die deutschen Stände, d. h. die Fürsten und Reichsstädte. Ihre Untertanen mussten dem Glauben ihrer Herrscher folgen oder durften auswandern. Der Augsburger Religionsfrieden läutete eine lange Friedensperiode in den deutschen Ländern ein, die erst mit dem Dreißigjährigen Krieg 1618 endete.
Was können Sie aus diesem Text über die Verwendung historischer Karten lernen? Inwiefern sind sie hilfreich und inwiefern irreführend?
Weitere Informationen über den Augsburger Religionsfrieden finden Sie unter On Site, In Time.
Weitere Informationen zu diesem und anderen Friedensverträgen finden Sie unter