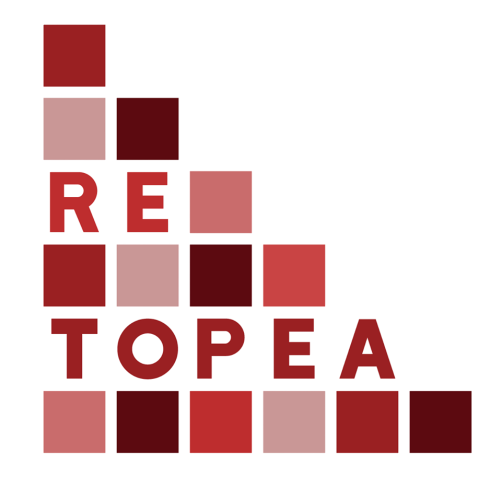Augsburg 1555 - Artikel 24-27
Im Augsburger Religionsfriedensvertrag von 1555 einigten sich die Gesandten der deutschen Länder und Städte darauf, in ihren Gebieten nur das katholische oder das lutherische Bekenntnis zu akzeptieren. Personen, die dem anderen Glauben angehörten, konnten auswandern. In einigen Städten bestanden beide Konfessionen jedoch weiterhin nebeneinander:
§ 24: Wenn aber Untertanen, die der alten Religion oder dem Augsburger Bekenntnis anhängen, wegen ihrer Religion mit ihren Frauen und Kindern das Land verlassen wollen, dann sollten sie das tun dürfen. Sie dürfen auch ihr Hab und Gut frei verkaufen. Aber sie müssen eine angemessene Entschädigung für Leibeigenschaft und Steuern zahlen.
§ 27: In vielen Städten des Reiches werden die beiden Religionen, die alte Religion und die Religion des Augsburger Bekenntnisses, nebeneinander praktiziert. So soll es auch in diesen Städten bleiben. Keine Seite darf versuchen, die Religion, die kirchlichen Bräuche oder die Zeremonien der anderen abzuschaffen. Nach diesem Frieden sollen sie ruhig und friedlich zusammenleben."
Further information about The Peace of Augsburg can be found at On Site, In Time.
For more information on this and other peace treaties, see
Titel
content
§ 27: In vielen Städten des Reiches werden die beiden Religionen, die alte Religion und die Religion des Augsburger Bekenntnisses, nebeneinander praktiziert. So soll es auch in diesen Städten bleiben. Keine Seite darf versuchen, die Religion, die kirchlichen Bräuche oder die Zeremonien der anderen abzuschaffen. Nach diesem Frieden sollen sie ruhig und friedlich zusammenleben."
Context
1555 trafen sich die Gesandten der deutschen Länder in Augsburg. Sie suchten nach einem Weg, den Konflikt zu lösen und die Religionskriege in Deutschland zu beenden. Der Augsburger Religionsfrieden vom 25. September 1555 akzeptierte schließlich die Existenz zweier verschiedener christlicher Kirchen. Die Fürsten und Herrscher konnten sich entscheiden, ob sie bei der alten katholischen Kirche bleiben oder dem neuen lutherischen Glauben, wie er im Augsburger Bekenntnis von 1530 formuliert wurde, anhängen wollten. Die lutherischen Staaten waren nun den katholischen gleichgestellt. Andere religiöse Gruppen, die mit der Reformation aufkamen, wurden jedoch vom Friedensvertrag ausgeschlossen. Die Religionsfreiheit galt nur für die deutschen Stände, d.h. die Fürsten und Reichsstädte. Ihre Untertanen mussten dem Glauben ihres Landesherrn folgen oder durften auswandern. Der Augsburger Frieden läutete eine lange Friedensperiode in den deutschen Ländern ein, die erst mit dem Dreißigjährigen Krieg 1618 endete.