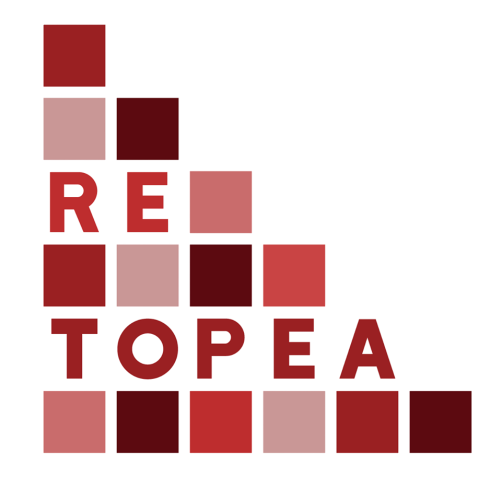Augsburg 1555 - Artikel 9-10, 14
Im Augsburger Religionsfriedensvertrag einigten sich die Verhandlungsführer auf einen Frieden, ohne dass sie über die Frage der Religion eine Entscheidung getroffen hätten:
‘§9-10: Bei der Konsultation wurde schnell deutlich, dass die Verhandlungen über die Hauptfragen unseres Heiligen Christlichen Glaubens, über Zeremonien und kirchliche Praktiken, schwierig sind. Eine endgültige Einigung wird daher nicht in absehbarer Zeit erzielt werden. Alles deutet darauf hin, dass es im Heiligen Reich der Deutschen Nation noch viele weitere Kriege geben wird. Daher wurde es von den Ständen, Botschaftern und Gesandten als sinnvoll erachtet, die Frage der Religion auf einen anderen geeigneten Zeitpunkt zu verschieben.
§14: Wir beschließen daher, dass niemand den anderen bekämpfen, berauben, einsperren oder belagern darf. Niemand darf Burgen, Städte, Festungen oder Dörfer gewaltsam erobern oder zerstören. Jeder sollte den anderen mit Freundschaft und christlicher Liebe behandeln. Jedes Gut hat zusammen mit den anderen Gütern den folgenden religiösen Frieden und auch den allgemeinen Landfrieden zu beachten.
Further information about The Peace of Augsburg can be found at On Site, In Time.
For more information on this and other peace treaties, see
Titel
content
‘§9-10: Bei der Konsultation wurde schnell deutlich, dass die Verhandlungen über die Hauptfragen unseres Heiligen Christlichen Glaubens, über Zeremonien und kirchliche Praktiken, schwierig sind. Eine endgültige Einigung wird daher nicht in absehbarer Zeit erzielt werden. Alles deutet darauf hin, dass es im Heiligen Reich der Deutschen Nation noch viele weitere Kriege geben wird. Daher wurde es von den Ständen, Botschaftern und Gesandten als sinnvoll erachtet, die Frage der Religion auf einen anderen geeigneten Zeitpunkt zu verschieben.
§14: Wir beschließen daher, dass niemand den anderen bekämpfen, berauben, einsperren oder belagern darf. Niemand darf Burgen, Städte, Festungen oder Dörfer gewaltsam erobern oder zerstören. Jeder sollte den anderen mit Freundschaft und christlicher Liebe behandeln. Jedes Gut hat zusammen mit den anderen Gütern den folgenden religiösen Frieden und auch den allgemeinen Landfrieden zu beachten.
Context
1555 trafen sich die Gesandten der deutschen Staaten in Augsburg. Sie suchten nach einem Weg, den Konflikt zu lösen und die Religionskriege in Deutschland zu beenden. Der Augsburger Religionsfrieden vom 25. September 1555 akzeptierte schließlich die Existenz von zwei verschiedenen christlichen Kirchen. Die Fürsten und Herrscher konnten entscheiden, ob sie bei der alten katholischen Kirche bleiben oder sich an den neuen lutherischen Glauben halten wollten, wie er im Augsburger Bekenntnis von 1530 formuliert wurde. Die lutherischen Staaten waren nun den katholischen gleichgestellt. Andere Religionsgemeinschaften, die mit der Reformation auftraten, wurden jedoch vom Friedensvertrag ausgeschlossen. Die Religionsfreiheit galt nur für die Reichsstände, d.h. die Fürsten und Reichsstädte. Ihre Untertanen mussten dem Glauben ihres Herrschers folgen oder durften auswandern. Der Augsburger Frieden läutete eine lange Zeit des Friedens in den deutschen Ländern ein, die erst mit dem Dreißigjährigen Krieg 1618 endete.