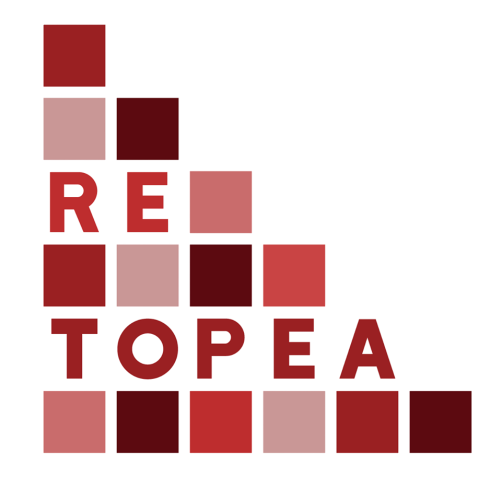Aus dem Abkommen von Belfast/Good Friday, 10. April 1998
Die Parteien bekräftigen ihr Engagement für den gegenseitigen Respekt, die Bürgerrechte und die Religionsfreiheit aller Mitglieder der Gemeinschaft. Vor dem Hintergrund der jüngsten Geschichte des kommunalen Konflikts bekräftigen die Parteien insbesondere:
- das Recht auf freies politisches Denken;
- das Recht auf Religionsfreiheit und freie Meinungsäußerung;
- das Recht, demokratisch nationale und politische Bestrebungen zu verfolgen;
- das Recht, mit friedlichen und legitimen Mitteln eine Verfassungsänderung anzustreben;
- das Recht auf freie Wahl des Wohnortes;
- das Recht auf Chancengleichheit bei allen sozialen und wirtschaftlichen Aktivitäten, unabhängig von Klasse, Glauben, Behinderung, Geschlecht oder ethnischer Zugehörigkeit;
- das Recht auf Freiheit von Belästigungen durch Sekten; und
- das Recht der Frauen auf volle und gleichberechtigte politische Beteiligung.
Kontext:
Das Karfreitagsabkommen erhielt seinen Namen von dem Tag im christlichen Kalender, an dem es unterzeichnet wurde. Es ist auch bekannt als das Belfast-Abkommen, nach der Stadt, in der es vereinbart wurde, nämlich der Hauptstadt Nordirlands. Es war sowohl ein Abkommen zwischen den verschiedenen politischen Parteien in Nordirland selbst als auch ein Abkommen zwischen den beiden Regierungen des Vereinigten Königreichs und der Republik Irland, die für die Umsetzung des Abkommens verantwortlich waren. Es sollte dem dreißigjährigen gewaltsamen Konflikt (bekannt als "The Troubles") ein Ende setzen. Der größte Teil des Abkommens befasst sich mit der Schaffung neuer politischer Strukturen, aber die oben zitierte Passage enthält wichtige allgemeine Grundsätze darüber, wie Menschen behandelt werden sollten. Insbesondere werden in diesem Abschnitt die Rechte in Bezug auf die Religion neben einer Reihe anderer wichtiger Menschenrechte dargelegt. Die Menschen sollen ihre Religion frei wählen und zum Ausdruck bringen können. Sie müssen auch die gleichen Möglichkeiten haben, unabhängig von ihrer Religion ("Glaubensbekenntnis"). Und sie dürfen wegen ihrer Religion nicht schlecht behandelt werden ("sektiererische Belästigung").
For more information on this and other peace treaties, see
Titel
content
- das Recht auf Religionsfreiheit und freie Meinungsäußerung;
- das Recht, demokratisch nationale und politische Bestrebungen zu verfolgen;
- das Recht, mit friedlichen und legitimen Mitteln eine Verfassungsänderung anzustreben;
- das Recht auf freie Wahl des Wohnortes;
- das Recht auf Chancengleichheit bei allen sozialen und wirtschaftlichen Aktivitäten, unabhängig von Klasse, Glauben, Behinderung, Geschlecht oder ethnischer Zugehörigkeit;
- das Recht auf Freiheit von Belästigungen durch Sekten; und
- das Recht der Frauen auf volle und gleichberechtigte politische Beteiligung".
Beschreibung
Context
Insbesondere werden in diesem Abschnitt die Rechte in Bezug auf die Religion neben einer Reihe anderer wichtiger Menschenrechte dargelegt. Die Menschen sollen ihre Religion frei wählen und zum Ausdruck bringen können. Sie müssen auch die gleichen Möglichkeiten haben, unabhängig von ihrer Religion ("Glaubensbekenntnis"). Und sie dürfen wegen ihrer Religion nicht schlecht behandelt werden ("sektiererische Belästigung").